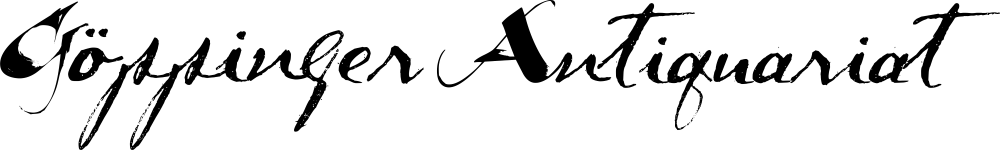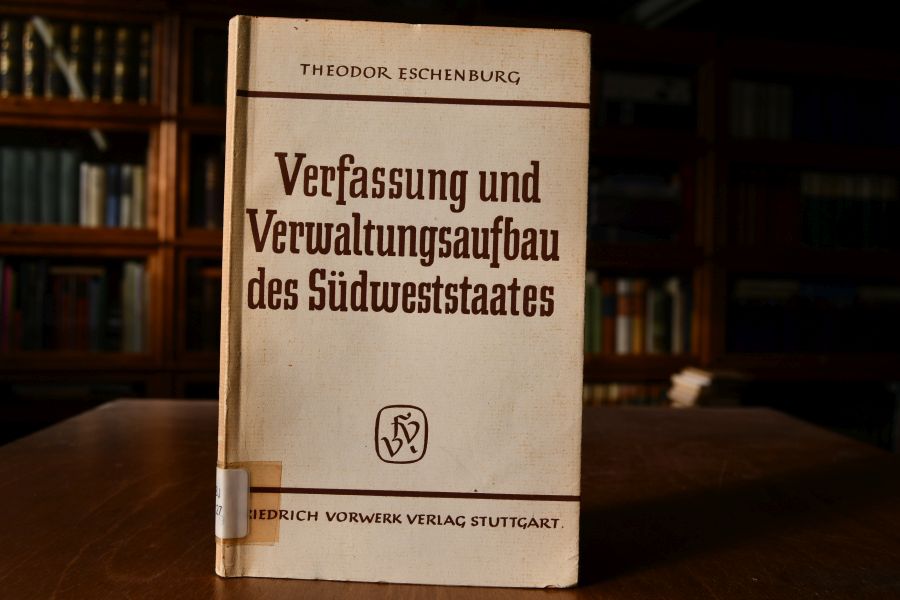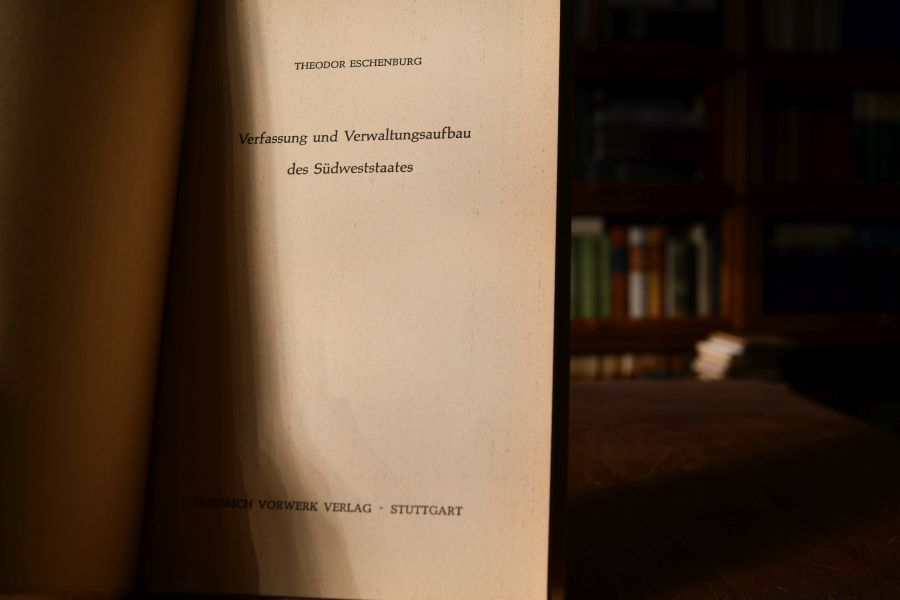Verfassung und Verwaltungsaufbau des Südweststaates.
Eschenburg, Theodor:
Erscheinungsjahr 1952
Verlag Stuttgart, Vorwerk,
Beschreibung Einband berieben, bestoßen und angeschmutzt. Bibliotheksexemplar mit den üblichen Aufklebern, Stempeln ujnd Eintragungen. Papierbedingt gebräunt. Gutes Leseexemplar.
Format 21 x 14 cm, Broschur
Bestellnummer 30873
Sprache Deutsch
Seiten 88 S.
EUR
21,00